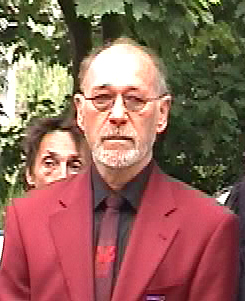Erinnerungen
an meine Kindheit in Löbau
Als Löbau 1920 zu Polen kam,
votierten meine Großeltern väterlich und meine Eltern für Polen.
D.h., sie nahmen die polnische Staatsangehörigkeit an, damit es ihnen
– Mutter ausgenommen – als Wolynien-Deutsche
nicht noch einmal so erging wie im 1. Weltkrieg, als sie ihren
Hof an Russland verloren, Löbau ihre neue Heimat wurde.

Zwei Schwestern und ein Bruder meines Vaters wollten sich nicht dem
polnischen Zwang beugen, verließen Westpreußen und fanden eine
Heimstatt in Ostpreußen – so wie die komplette Familie meiner
Mutter – sie natürlich ausgenommen – die Tergewisch verließ.
Onkel Waldemar, ein
Bruder meines Vaters, damals 12-jährig. blieb
natürlich in Löbau – bis 1939. In Polen heranwachsend,
unterlag er u.a. der Mititärpflicht, d.h. er musste beim polnischen
Militär dienen. 1939 machte Polen mobil. Das war das Signal für ihn
und seine Frau, sich nach Ostpreußen abzusetzen. Damit entzog er sich
dem polnischen Gestellungsbefehl.
Es bedarf nicht
vieler Fantasie, sich vorzustellen, dass ab 1920 die Uhren für die
Deutschstämmigen anders gingen. Ich erinnere mich einer Begebenheit
im November 1938 : mein Bruder Helmut und ich hielten Ausschau nach
dem Storch, der uns ein Geschwister bringen sollte, unsere Schwester.
Bei ihrer Namensgebung hatten meine Eltern darauf zu achten, dass der
Name ins Polnische übersetzt werden konnte. Das Standesamt trug nur
polnische Vornamen ins Register ein. Aber das war nicht alles. Die
Polonisierung von Namen – auch Nachnamen – zog weitere Kreise und
hatte gelegentlich komische Züge (mit für uns bitterem
Beigeschmack): Post aus dem Reich an meinen Vater, mit Vornamen und
Nachnamen, wurde korrigiert. Sein Vorname, Albert, war
durchgestrichen. Man zwang ihn, sich Woidek zu nennen. Wolle er den
Rufnamen Albert beibehalten, müsse er nach Deutschland auswandern,
wie man ihm bedeutete.
Da
die Stimmung gegen Deutschland wenig gut war, war sie auch nicht gut
gegen die Bürger deutscher Herkunft. Sie wurden bespitzelt. Gewarnt,
verhielt man sich entsprechend. Unser Hof lag abseits des Ortes, d.h.,
wer uns daheim belauschen wollte, musste einen Spaziergang auf sich
nehmen. Man ist oft zu uns spaziert. Fußspuren haben die Lauscher
unter unseren Fenstern, unter denen abends stets der Boden geharkt
wurde, entlarvt. Nachbarn hatten es uns gesteckt, Polen. D.h. nicht
alle Polen waren gegen uns. Ich habe noch immer das Bild vor Augen,
als ein Nachbar – ein Pole – mit der Peitsche Polinnen von unserem
Kornfeld vertrieb, die Ähren von den Garbenhocken schnitten.
Im Sommer 1939
erlebte die Garnisonsstadt Löbau eine große Parade. Ich erinnere
mich besonders an die Teilnahme einer Kavallerieabteilung, bewaffnet
mit Lanzen und Degen. Das war wohl ein Vorbote für den 31.8.1939. Da
erschienen drei bewaffnete Soldaten auf Fahrrädern bei uns auf dem
Hof, sprachen kurz mit unserem Vater und bezogen – wohl des guten
Sichtfeldes nach Bischwalde wegen – Stellung in unsrem Kartoffelfeld. Unterstützend flog ein
kleines Militärflugzeug ziemlich tief zweimal die Gegend ab. Der Spuk
fand ein Ende, als ein vierter Soldat, sehr eilig, seine drei
Kameraden vom Feld holte. Am 1.9.39, gegen 6 Uhr, erfuhr mein Vater
von einem Nachbarn, deutsche Soldaten seien in der Stadt. Diese
Nachricht erschien meinem Vater unglaubwürdig – es war kein Schuß
gefallen, ganz zu schweigen von Kampfhandlungen. Doch sie stimmte. Die
polnischen Soldaten hatten offenbar die Stadt rechtzeitig verlassen.

Abbildung
:1940 vor der Scheune: hinten, in der Mitte, Mutter und Vater mit
Christel, von links Cousine
Selma, Helmut, Alfred und Heinz.
Die Straße von
Bischwalde nach Löbau war ein paar Tage voll von Kolonnen deutscher
Soldaten – Rheinländer und Westfalen. Wir waren frei und durften
wieder deutsch sein, deutsch nicht nur in der Familie und der ev.
Kirche reden – ohne Angst zu haben.
Angstfrei sahen
viele Polen die neue Situation gewiß nicht. Diejenigen, die sich 1920
deutschen Eigentums bemächtigt hatten, mussten es zurückgeben,
diejenigen, die sich Deutschen gegenüber etwas zu schulden hatten
kommen lassen, verloren ihren Besitz. Sehr hart traf es die jüdische
Bevölkerung. Sie wurde abtransportiert, ihre Synagoge wurde zerstört
und ihr Friedhof zu Ackerland gemacht.
Ein großer Teil
Polen, die wir kannten, wollten „eingedeutscht“ werden. Dazu
bedurften sie des Nachweis eines deutschen Vorfahren und der Fürsprache
eines Löbau-Deutschen. Damit hatten sie als Volksdeutsche die
gleichen Rechte und Pflichten wie ein Deutscher. Das bedeutete u.a.
damals: sie konnten zur Wehrmacht eingezogen werden und mussten u.U.
im Kampf ihr Leben lassen.
All die
beschriebenen Verwaltungsakte gingen von deutschen Beamten aus, die
mit ihren Familien aus dem Reich gekommen waren und alle
Verwaltungsstellen besetzten. Es galt wieder deutsches Recht.
Das Leben ging nach
ein paar Wochen scheinbar seinen normalen Gang, zumindest für mich.
Nach ½ Jahr Kindergarten kam ich 1940 mit 7 Jahren in die Schule. 9-jährig
fuhr ich mit dem Zug von Löbau zur Erholung in ein Kinderheim am
Frischen Haff – meine erste Trennung von der Familie.
Obwohl noch keine 10
Jahre alt – das vorgeschriebene Eintrittsalter – ging ich zum
Jungvolk. Ich wollte meinen Brüdern nicht allzu sehr nachstehen –
der eine war bei der HJ, der andere Soldat. Außerdem reizte die
Uniform. Und Spaß hat mir die Mitgliedschaft bei Sport und Spiel außerdem
gemacht.
Im Herbst 1944 ging
die scheinbare Ruhe, die 39 eingekehrt war, zu Ende. Wir Schulkinder
mussten zur Kartoffelernte, Bauernfuhrwerke holten uns ab. In der
Kaserne mussten wir Strohsäcke mit Stroh füllen, weil die Soldaten
– Marineinfanteristen – die sich nur kurze Zeit zur Ausbildung in
Löbau aufhielten, dazu nicht kamen. Die Bauern mussten im Kreisgebiet
Gespanndienste leisten. Ich erinnere mich, wie mein Bruder und
ich gelegentlich einer solchen Verrichtung in die Dunkelheit kamen und
nur mit großer Mühe nach Hause fanden, wo unsere besorgten Eltern
auf uns warteten. Ihre Sorge war begründet, die Straßen waren nicht
mehr sicher.
Im Dezember 1944
wurde die Schule zum Teil als Lazarett genutzt oder als Unterkunft. Im
Januar 1945 zogen die ersten Flüchtlingstrecks durch die Stadt. Und
dann ging es los Straßensperren, Erdunterstände und Schützengräben
anzulegen. Unser Feld wurde dabei nicht geschont. Die Arbeit war
schwer, der Boden war hart gefroren.
Unser Vater war zu
der Zeit fast nur noch auf dem Amt. Am 18. Januar kam er so gegen 10
Uhr nach Hause und sagte, wir sollten den Wagen fertig machen und für
die Flucht packen. Am 19. Januar, gegen 8 Uhr, kamen 3 Soldaten mit
auf gepflanztem Gewehr auf den Hof und gaben das Zeichen zur Abfahrt.
Der Hofhund, der mitkommen sollte, blieb am Zaun stehen und schaute
uns nach.
Unser Vater hat sich
von uns auf dem Marktplatz verabschiedet. Seine letzten Worte, zur
Mutter gewandt, waren: „wird es ein Wiedersehen geben?“ Dann ging
der große Treck los, Angst und Gefahren lagen vor uns.
Ich habe Löbau und
den elterlichen Hof im Juli 1975, zusammen mit meiner Frau, den beiden
Söhnen, meinen Geschwistern Heinz, Helmut, dessen Ehefrau, Christel
und ihren Ehemann, wiedergesehen.
Alfred Brandt , ehemals Löbau

Löbau/Westpr. (Lubawa)
Neumark/Westpr. (Nowe Miasto Lubawskie)