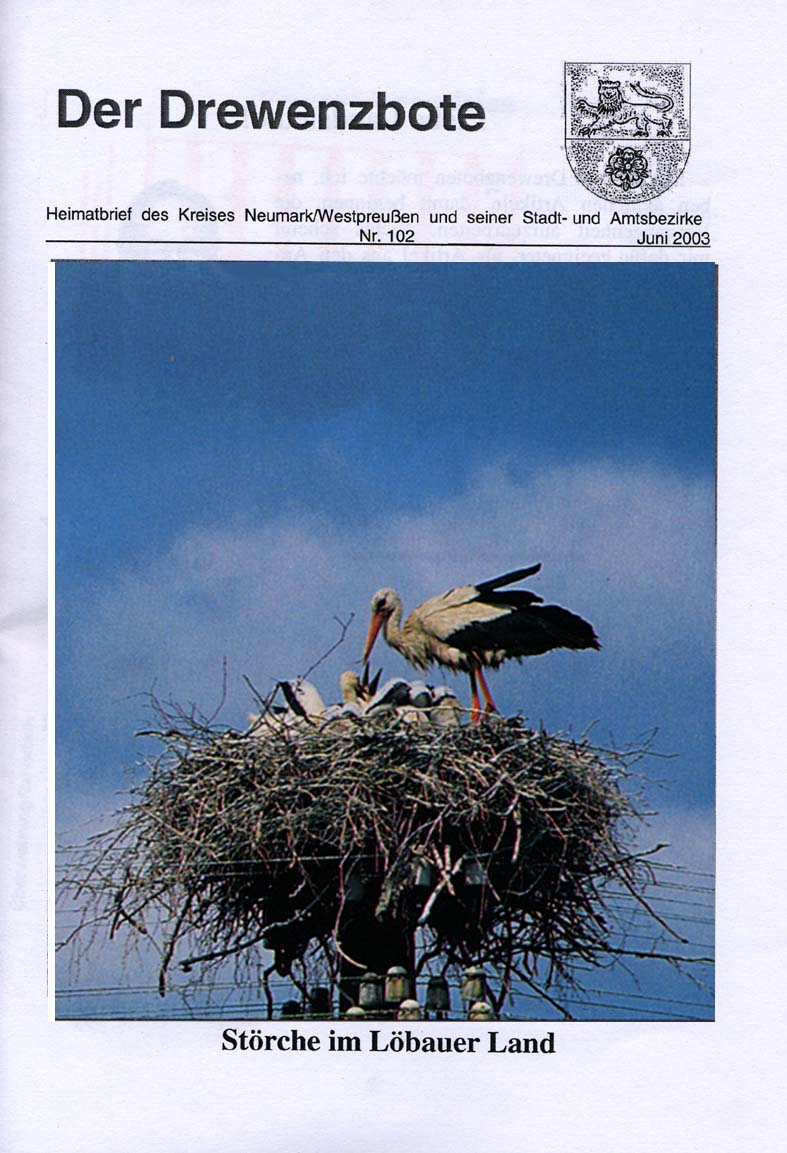Der 20. Januar 1920 war in der Geschichte der Stadt Löbau/Westpr.
ein schwarzer Tag, als sie ohne
Volksabstimmung durch den Versailler Friedensvertrag an Polen abgetreten
wurde. Die Nachbarkreise Osterode und Rosenberg, nur zehn Kilometer
entfernt, blieben deutsch. Der 21. Januar 1945 ist aber zweifellos der schwärzeste
Tag. Die Rote Armee
erobert es und steckt Löbau in Brand, so daß es ein Trümmerhaufen wird. Am 18. Januar
1945 ergeht der Räumungsbefehl. In der Nacht zum 19. fährt der Sonderzug
und bringt einen Teil der Bevölkerung
in die Stadt Berent, die
zum Aufnahmegebiet für Löbau seit dem Herbst 1944 bestimmt ist. Seit
dem frühen Morgen des 19. Januar durchziehen Flüchtlingstrecks die
Stadt. Am Vormittag schließt sich der Löbauer Treck mit dem Marschziel Berent auf vorgeschriebenem Wege an.
Am
19. Januar Nachmittag treffen aus Danzig 0mnibusse und Lastkraftwagen für die Evakuierung ein.
Sie fahren teilweise leer ab. Am 20. Januar
vormittags wird noch ein Sonderzug gestellt, der schwach besetzt abfährt. Der fahrplanmäßige Zugverkehr wickelt sich
bis zum Abend des 20. Januar 1945 ab. Am Morgen des 20. Januar treffen Flüchtlinge aus
Lautenburg ein. Sie
berichten, dass Lautenburg brennt. Sie werden verpflegt und
weitergeleitet. Die Geschäfte
sind seit dem
19. geschlossen, es
gibt auch keinen Strom. Die polnische Bevölkerung hat zum größten
Teil keinen Gebrauch von
den Sonderzügen und sonstigen Fluchtmöglichkeiten
gemacht. Sie hat sich in die umliegenden Dörfer begeben. In der Stadt
sind fast keine Zivilisten, sondern
nur durchziehende
Soldaten und Volkssturmmänner zu sehen. Es ist ruhig.
Am Abend kommt
die Nachricht, daß
Löbauer Volkssturm in
Schweinichen von russischen Panzern
überfallen und zusammengeschossen
wurde. Dabei soll
Kompanieführer Reuter gefallen sein. Gegen 18 Uhr sind Einschläge
russischer Granaten in der Stadt. Dann wird es wieder ruhig. Von der
Lautenburger Straße hört man in der
Ferne MG-Feuer, sieht
Brände. Montau soll
brennen. Der Russe soll
dort und in Grodden sein. Eine Fernsprechverbindung mit
der Kreisstadt Neumark/Westpr. ist nicht mehr möglich.
Die
Nacht zum
21. Januar
verläuft sonst
ruhig. Das Durchziehen
von Soldaten hat aufgehört. Man
hat das Gefühl
der Ruhe vor
dem Sturm. Keiner weiß was eigentlich
los ist. Ein gefangener Russe, bei Tuschau
gefangen, wird
eingebracht. Verwundete in das Krankenhaus Löbau eingeliefert.
Am
21. Januar 1945 gegen 8 Uhr hört man Gewehr- und MG- und
Geschützfeuer. Einschläge in der Stadt. Die schwache Garnison
wehrt sich. Der Russe greift an. Der Gefechtslärm steigert sich. Ein
großer Teil der Fensterscheiben platzt. Gegen 12 Uhr hört die Schießerei
auf . Gegen 12.30 Uhr sind
die ersten Russen in der
Stadt. Auf jede Bewegung in den Häusern
wird geschossen. Im
Krankenhaus waren sieben oder neun Schwerverwundete deutsche Soldaten
mit einem deutsche Arzt zurückgeblieben. Dieser
wird abgeführt, die
Verwundeten umgebracht.(Der Arzt wurden später von den Russen auch
erschossen. d.R.). Selbst Polen waren über diese
Tat empört und sagten, daß so etwas die
Deutschen nie getan hätten. In der Stadt
zertrümmern Kolbenschläge Fenster und Türen. Der übliche Ruf „Uhre,
Uhre" ertönt. Griffe an die Handgelenke, drohende Gebärden.
Ganze Horden stürmen herein,
alles wird durchgewühlt und was brauchbar erscheint, darunter
auch die
Lebensmittel, mitgenommen. Die Möbel durch
Kolbenschläge zertrümmert. Natürlich kam auch die Forderung
“Komm Frau".
Selbst vor 80jährigen wurde
nicht haltgemacht. Man machte keinen Unterschied zwischen Deutschen und
Polen.
Am
Nachmittag brannte das Gymnasium, das von
der Garnison als Stabsgebäude benutzt wurde. Auch in Richtung
Lautenburger Straße war Feuerschein. In
der Dämmerung brachte ein Russe auf einem
Schlitten Päckchen
in die
Kaserne (Seminar).
Kurz darauf brannte sie lichterloh. In
einem Nebengebäude
explodierte Munition mit großem Krachen.
Das Postamt brannte zu gleicher Zeit.
Auch in der ganzen
Stadt wüteten Brände. Sie
war taghell erleuchtet. Die Plünderungen und Schändungen gingen die
ganze Nacht durch. Die alten Jaguschs
hatten noch
in dieser Nacht
Ruhe, da bei ihnen ein
russischer Stab
Quartier bezogen hatte,
der sich
anständig verhielt. Die alte Frau Lack in der Kuppnerstraße und
Frau Plath in der
Kopernikusstraße erhängten
sich.
Nach der Feuersbrunst standen am Markt nur noch drei Häuser, die neue
Apotheke, Kaisers Kaffeegeschäft und Melzer. Alles andere ist
ein Trümmerhaufen. In der Warschauer Straße ist auf
der einen Seite alles, einschließlich Rathaus, mit Ausnahme der
Drogerie, abgebrannt. Auf der gegenüberliegenden
Seite sind
mehr Gebäude stehen
geblieben. In der Danziger Straße sind die Gebäude Nr. 2, 4, 6, 8, 10.
18, mehrere Grundstücke gegenüber dem
evangelischen Friedhof, das Baugeschäft Jahnke, das Wohnhaus der
Untermühle, das Gymnasium, Nr. 21, die Kaserne (Seminar), das Postamt,
Nr. 7, 3, das Grundstück Tysler, das
Deutsche Haus, der Feuersbrunst anheimgefallen. In der Kuppnerstraße
ist das Lichtspieltheater, das Grundstück Schneider und
Koscorreck, sowie mehrere Wohngebäude, vernichtet. In der
Deutsch-Eylauer Straße stehen das Krankenhaus, das Gefängnis und die
Barbarakirche. Das Amtsgericht und das Finanzamt sind mit zerstört,
desgleichen die Molkerei in der Kopernikusstraße. In den übrigen Straßen
sind gleiche Verwüstungen. Die drei Kirchen sind stehen geblieben. Die
Türme weisen erhebliche Beschädigungen durch Beschuß auf. In den Straßen
liegen noch mehrere Tage nach der Besetzung die gefallenen deutschen
Soldaten, ferner Haustiere, Hausrat und Lebensmittel.
Die polnische
Bevölkerung kehrt
allmählich von den umliegenden Dörfern zurück. Sie geht verstört
durch die Straßen, denn ein sehr großer Teil hat Wohnung und
Einrichtung verloren. Die Polen rücken in den stehengebliebenen Grundstücken
zusammen und holen sich zusammen, was zu finden ist. Die zurückgebliebenen
Deutschen werden aus ihren Wohnungen und Besitz geworfen. Sie dürfen
nichts mitnehmen. Sie wurden mit Totschlag bedroht, falls sie sich in
ihrem Besitz wieder sehen ließen. Die Deutschen sammeln sie auf
dem Grundstück Jagusch in der
Danziger Straße.
Hierher bringen die Polen auch eines Tages die bessarabien-deutsche Frau
Heß mit drei Kindern aus Samplau. Sie ist schwer verwundet und braucht
dringend ärztliche Behandlung. Der Krankenhausarzt lehnt Hilfeleistung
mit der Begründung ab, daß es ihm untersagt sei, zu Deutschen zu
gehen. Auch die Nonnen verweigerten Hilfe wegen der Unsicherheit auf der
Straße. Es wird berichtet, daß auch sie alle geschändet wurden. Eine
verletzte deutsche Frau wurde aber an demselben Tage vom Arzt behandelt
(im Krankenhaus) und diese erhielt auch für Frau Heß Verbandszeug.
Frau Heß wurde später in das Krankenkenhaus eingeliefert, wo sie in
einem sauberen Bett mit sauberem Verbandszeug, in einem Raum mit
polnischen Patienten bei einem Besuch durch eine Leidensgefährtin
angetroffen wurde.
Sie klagte nicht, verstarb aber um die Osterzeit und wurde auf
dem evangelischen Friedhof durch deutsche Männer beigesetzt. Was mag
aus ihren Kindern geworden sein? Die Nonnen haben eine deutsche
Verletzte mehrmals im Krankenhaus verbunden.
Die
Wochen nach der Besetzung waren schlimm. Im Hause Jagusch waren
17 Deutsche.
Die Ernährung machte Schwierigkeiten. Dazu die dauernden Ängste
und Aufregungen vor den Russen. Sie waren nicht eine Minute am Tage oder
in der Nacht vor diesen sicher. Sie wagten es nie, sich schlafen zu
legen. Die Haustüre durfte nicht abgeschlossen werden. Angstvoll
horchte man auf sich nähernde Schritte. Bei den Polen haben sich die
Russen in den ersten Wochen nicht besser benommen.
Die
polnische Stadtverwaltung richtete sich in der Kuppnerstraße im
Hauptschulgebäude ein und die russische Kommandantur im Café Pior. Bürgermeister
wurde ein bei Deutschen und Polen in keinem guten Ruf stehender, aus dem
ersten Weltkrieg zurückgebliebener russischer Kriegsgefangener namens
Boryna. Er nahm von der Bogunschen Landwirtschaft Besitz. Boryna benahm
sich den Deutschen gegenüber sehr gemein. Er war
meistens betrunken und hatte als Zeichen seiner Würde eine
Maschinenpistole umgehängt, mit der er immer bedrohlich herumfuchtelte,
wenn er von einem Haufen
polnischer Miliz begleitet,
die Deutschen heimsuchte. Alle atmeten auf, wenn die Tortur der
Durchsuchung und Verhöhnung wieder einmal überstanden war. Niemand
durfte deutsches Geld besitzen. Es mußte abgeliefert werden. Polnisches
Geld hatten in dieser Zeit weder die deutschen noch die polnischen
Einwohner. Es wurden
deshalb Bezugscheine für Brot, Fleisch
und Säuglingsmilch ausgegeben. Bezahlt brauchte nicht zu werden.
Es gab aber nur sehr schlechte Qualitäten. Das Fleisch war ganz schwarz
und stammte wahrscheinlich
von verendeten, nicht ausgebluteten Tieren. Dafür mußten sich Deutsche
und Polen täglich acht Stunden zur Arbeit stellen. Ein Russe und
polnische Miliz beaufsichtigten. Den Polen gefiel dieses gar nicht und
die Miliz hatte viel zu tun, sie heranzuholen.
Anfang
März erschien eines Morgens polnische Miliz unter Führung
eines Offiziers (Kruza aus Löbau) und erklärte, daß die
Deutschen in ein Lager kämen und in einer halben Stunde abmarschfertig
sein müßten. Betten dürften nicht
mitgenommen werden, aber für jeden zwei Decken
und Verpflegung für drei Tage. Man verschwieg aber, woher Decken
und Lebensmittel
genommen werden
sollten. Wohin würde es gehen? Zum Glück blieben sie in Löbau.
Es
ging auf das Kasernengelände. Hier
war an der Feldstraße zwischen den Pferdeställen die Waffenmeisterei,
ein kleines einstöckiges
Gebäude mit
vergitterten Fenstern stehen geblieben. Hier werden die deutschen
Frauen und Kinder auf Stroh in Etagenbetten untergebracht. Die Männer
kamen in das Gefängnis. Tag und Nacht erfolgte scharfe Bewachung durch
Miliz. Der Herd wurde erst gebaut. Die erste Mahlzeit gab es am dritten
Tag abends. Der Hunger war
schon in den verflossenen Wochen trainiert worden. Einen Abort gab es in
den ersten Tagen auch nicht. Bei der Aufnahme
in das Lager wurde jeder sehr
genau untersucht; alle Mantel-
und Kleidersäume
gründlich
abgefühlt und alles abgenommen, was die Polen gebrauchen
konnten, und wenn es nur ein alter Wecker war; denn es gab nicht mehr
viele Uhren in der Stadt. Am ersten Tag waren ca. 20 Frauen und Kinder
im Lager. Täglich kamen neue Einweisungen, von der Flucht Zurückgekehrte
oder in der Umgebung
aufgelesene. Es waren bald über 100 Personen in drei kleinen Räumen.
Lagerkommandant war ein gewisser Chylewski, ein Verwandter des Drogisten
Kaschubowski, und Lagerführer
der einarmige frühere
Nachtwächter des Sägewerks Gorczynski. Letzterer trug stets eine
lederne Reitpeitsche bei sich. Soweit bekannt, hat er nur einmal vier
Frauen geschlagen. Chylewski war sehr jähzornig und schlug wohin er
traf. Einmal hat er auch einen Internierten des Männerlagers, Neumann
aus der Lazarettstraße, geschlagen und übel zugerichtet,
trotzdem dieser ihm nicht unterstellt war.
Der
Lagerführer des Männerlagers im Gefängnis, Kowalski, soll anständig
gewesen sein und immer etwas
für die Mahlzeiten beschafft haben. Das
Essen im Frauenlager war nicht ausreichend, Brot
täglich 250 Gramm. Manchmal auch nur
für drei Tage 250 Gramm. Dann gab es einen halben Liter Kaffee
und Mittagessen. Wenn von letzterem
etwas übrig blieb, wurde es abends ausgegeben.
Sonst wurde abends
nichts verabfolgt.
In
den ersten vier Wochen waren noch in der Kaserne
eingemietete Möhren
und Steckrüben vorhanden;
auch wurden Kartoffeln aus dem Präkonwerk angeliefert.
Dann wurde die Lage kritisch. Jeder
war froh, am Arbeitsplatz vom polnischen Arbeitgeber noch zusätzlich
etwas zum zweiten Frühstück oder Nachmittagskaffee zu erhalten.
Schlimm war es für die Arbeitsunfähigen und für die Alten. Die
Polen mußten die
Arbeitsleistungen an das Lager bezahlen. Der Arbeitseinsatz erfolgte in
Trupps in der Landwirtschaft oder bei der Straßenreinigung, auch
einzelne im Haushalt. Im Anfang war die Bewachung sehr streng, sowohl
auf dem Wege zur Arbeit, als auch auf der Arbeitsstelle. Bis Pfingsten
hatte sich diese soweit gelockert, daß die Internierten alleine zur
Arbeit gingen. Hierdurch hatten sie Kontakt mit der Bevölkerung
und es wurde ihnen manches Stück Brot, manchmal auch ein Ei und
wenn das Glück es gut meinte, ein Stück Speck zugesteckt.
Es
hatte fast jeder seine Freunde
von früher, denen
es aber in der zerstörten Stadt auch nicht üppig ging. Im
Grunde hatten diese wohl Mitleid, aber sie konnten auch nichts
tun, weil sie zu denen,
die damals gerade am Ruder waren, keine Beziehung hatten oder sich
selbst vor diesen fürchten
mußten.
Ohne
diese heimlichen Zuwendungen hätten die Deutschen das Lager nicht überstanden.
Es gab natürlich auch Polen, die haßten und es die Internierten fühlen
ließen. Gemäß der Charta der Ostvertriebenen sollen deren
Namen vergessen werden.
Um Ostern kam für die deutschen Mütter im Lager ein trauriger Tag, als
alle Kinder in das Kloster (Krankenhaus) abgeliefert werden mußten. Es
hieß, sie sollten polnisch
erzogen werden. Diese Maßnahme ging nicht von den Nonnen aus. Die Mütter
durften aber die Kinder jeden zweiten Sonntag besuchen. Die Ungewißheit
über deren Schicksal machte den Angehörigen viel Sorge. Soweit
bekannt, erhielten aber alle Eltern ihre Kinder bei der Übersiedlung nach Deutschland zurück.
Im
Hochsommer wurden alle Arbeitskräfte aus dem Lager an Bauern in den
umliegenden Dörfern verteilt. Die „Eingedeutschten" wurden,
soweit sie im Lager waren, nach Hause entlassen. Die Alten und
Arbeitsunfähigen wurden sich selbst überlassen.
In der Stadt durfte ihnen keine
Unterkunft gewährt werden. Es wurde den Deutschen nahegelegt,
nach dem Westen abzuwandern. Die Reisetage waren furchtbar. Die
Deutschen waren Freiwild für Russen und Polen.
Frau
Heß war der einzige Todesfall im Lager. Die 52 in Löbau gefallenen
deutschen Soldaten, Frau Lach und Frau Plath ruhen in einem Massengrab
hinter dem katholischen Friedhof. Der Kommandeur der Löbäuer Garnison,
Korvetten-Kapitän Graf Schwerin ist unter ihnen (Wie später
berichtigt, ist er in Rosen beerdigt).
Im
Herbst 1945 begannen in der Stadt Löbau die Aufräumungsarbeiten. Wie
sieht es heute aus?
Es
kommen nur spärlich Nachrichten, da in Polen Auslandsbriefwechsel unerwünscht
ist. Im Jahre 1949 begann man, den evangelischen Friedhof in einen
Sportplatz zu verwandeln. Die katholische Gemeinde soll keinen
Geistlichen haben. Es waren früher immer mehrere tätig. Die Arbeitsmöglichkeiten
sind schlecht. Polnische Arbeiter sind nach Oberschlesien abgewandert.
Es wird auch Propaganda für eine Umsiedlung in die Gebiete zwischen
Weichsel und Oder gemacht. Das Dorf Kölpen soll zur Kolchose
zusammengeschlossen sein.
Rudolf Steege, Sen.
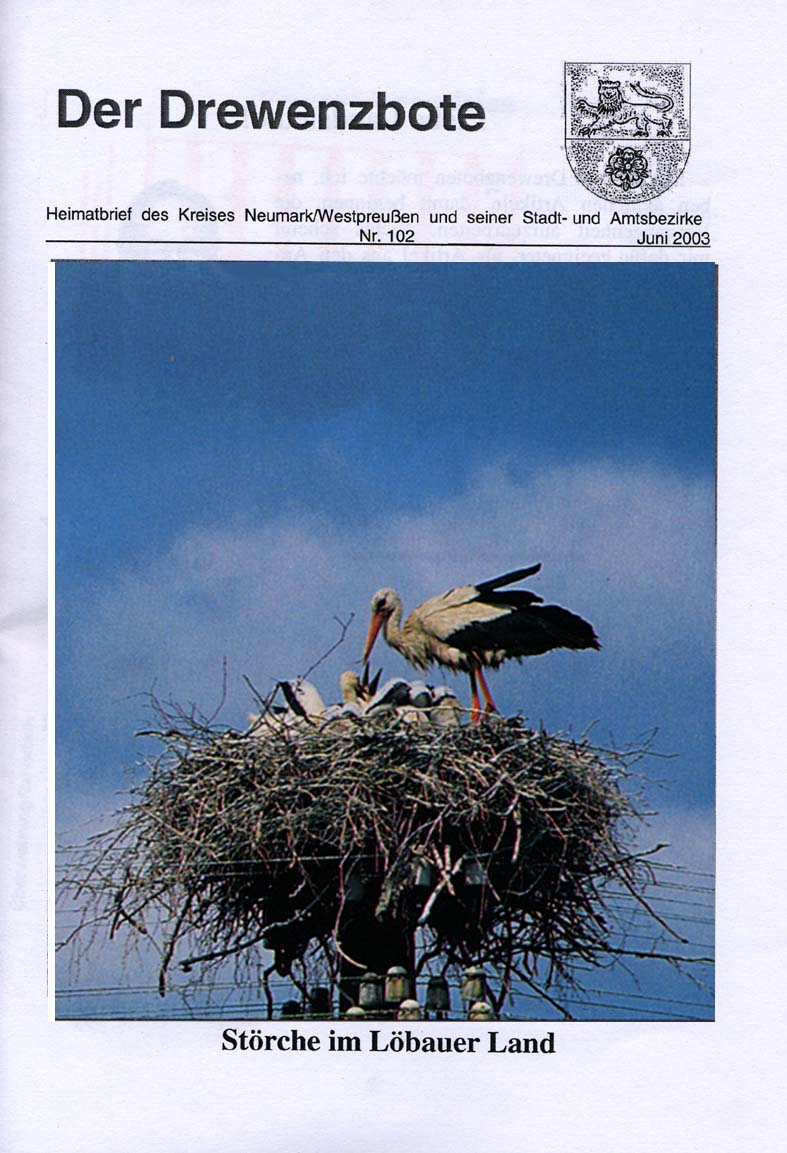
Löbau/Westpr. (Lubawa)
Neumark/Westpr. (Nowe Miasto Lubawskie)